Auch wenn es derzeit nicht den Anschein hat: Selbst wenn die Ärztinnen und Ärzte in den Spitälern ab 1. Jänner 2014 nur noch 48 statt maximal 72 Stunden pro Woche arbeiten, wird das österreichische Gesundheitssystem nicht zusammenbrechen. Jede Patientin und jeder Patient wird entsprechend versorgt werden.
Die Konflikte in einigen Bundesländern zwischen der Ärzteschaft und den Betreibern der Spitäler, meist den Ländern selbst, haben einen simplen Grund. Die Politik hat seit mehr als zehn Jahren EU-Recht negiert. Anstatt die zwischen den EU-Mitgliedsstaaten vereinbarte 48-Stunden-Woche für Spitalsärzte langfristig umzusetzen, wurde das Problem ignoriert und auf die lange Bank geschoben. So lang, bis Brüssel mit Strafen drohte. Jetzt ist Feuer am Dach.
Übrigens ist das nicht in allen Krankenhäusern so. In vielen Spitälern sind die Vorgaben bereits vor Jahren umgesetzt worden - und sie funktionieren klaglos.
Vor allem in Salzburg, Wien und Kärnten gibt es massiven Wirbel. Nicht nur weil durch die 48-Stunden-Woche deutlich mehr Ärzte notwendig sind. Sondern auch, weil die Mediziner, die in den Krankenhäusern bereits arbeiten, nicht gewillt sind, die Einkommensverluste zu akzeptieren, die durch die gesetzliche Arbeitszeitverkürzung entstehen.
Die Betreiber der Spitäler befinden sich so in einer fast ausweglosen Situation. Denn Mediziner sind knapp. In fast allen europäischen Staaten werden händeringend Ärztinnen und Ärzte gesucht. Meist zu besseren Arbeitsbedingungen und zu höheren Gehältern als in Österreich. Wie wenig attraktiv der Arztberuf inzwischen ist, zeigt, dass etwa 40 Prozent der Medizinstudenten, die an den heimischen Universitäten ausgebildet werden, nie in Österreich als Ärztin oder Arzt arbeiten.
So wird den Ländern als Spitalsbetreibern, auch wenn sie sich derzeit noch so winden, wohl nichts anders übrig bleiben als zu zahlen - für mehr Ärzte und für höhere Gehälter.
Aber selbst wenn die öffentliche Hand auf ihre leeren Kassen verweist, muss man mit ihr kein Mitleid haben. Die paar Millionen Euro, die sie die Einhaltung der 48-Stunden-Woche kosten wird, kann sie sich allemal leisten. Nur zum Vergleich: Die gesamten Gesundheitsausgaben in Österreich betragen pro Jahr rund 25 Milliarden Euro. Mit Gier oder Moral hat die ganze Auseinandersetzung, auch wenn es die Politik ab und zu gern suggerieren würde, ebenfalls nichts zu tun. Es geht um Gesetze und um die freie Marktwirtschaft, in der Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Die Mediziner haben das auch schon umgekehrt erlebt. Vor einigen Jahren gab es viel zu viele Ärztinnen und Ärzte und viel zu wenige Jobs. Und so mancher fertige Mediziner musste sich als Taxifahrer seinen Lebensunterhalt verdienen.
Noch dazu hat die Politik die Möglichkeit, etwas gegen die steigenden Kosten in den Spitälern zu unternehmen. Es ist ihre Aufgabe, das Gesundheitssystem effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Aber die bessere Abstimmung von niedergelassenen Ärzten und Spitälern wurde seit Jahren ebenso wenig angegangen wie das Vorhaben, die Strukturen in den Krankenhäusern schlanker zu machen. So drängen sich in den Ambulanzen der Spitäler, die eigentlich für Notfälle vorgesehen sind, immer noch Menschen mit kleinen Wehwehchen, die eigentlich zum Hausarzt gehören. So stehen viele Operationssäle nach 16 Uhr immer noch leer und medizinische Großgeräte vom Computertomographen bis zum Röntgen still.
Bei der Diskussion über kürzere Arbeitszeiten geht es aber nicht nur ums Geld. Für die Patientinnen und Patienten ist vor allem wichtig, dass sie von einer Ärztin oder einem Arzt betreut werden, der fit und leistungsfähig ist. Mediziner, die Tag und Nacht durchgearbeitet haben, sind das nicht. Studien zeigen, dass übermüdete und erschöpfte Ärztinnen und Ärzte nicht nur ihre eigene Gesundheit gefährden, sondern auch eine potenzielle Gefahrenquelle für die Patienten darstellen. Ein Mediziner, der länger als 24 Stunden im Dienst ist, ist so beeinträchtigt, als hätte er 0,8 Promille Alkohol im Blut. Das endlich zu ändern, dafür ist die Politik verantwortlich.
Originalbeitrag in: Salzburger Nachrichten
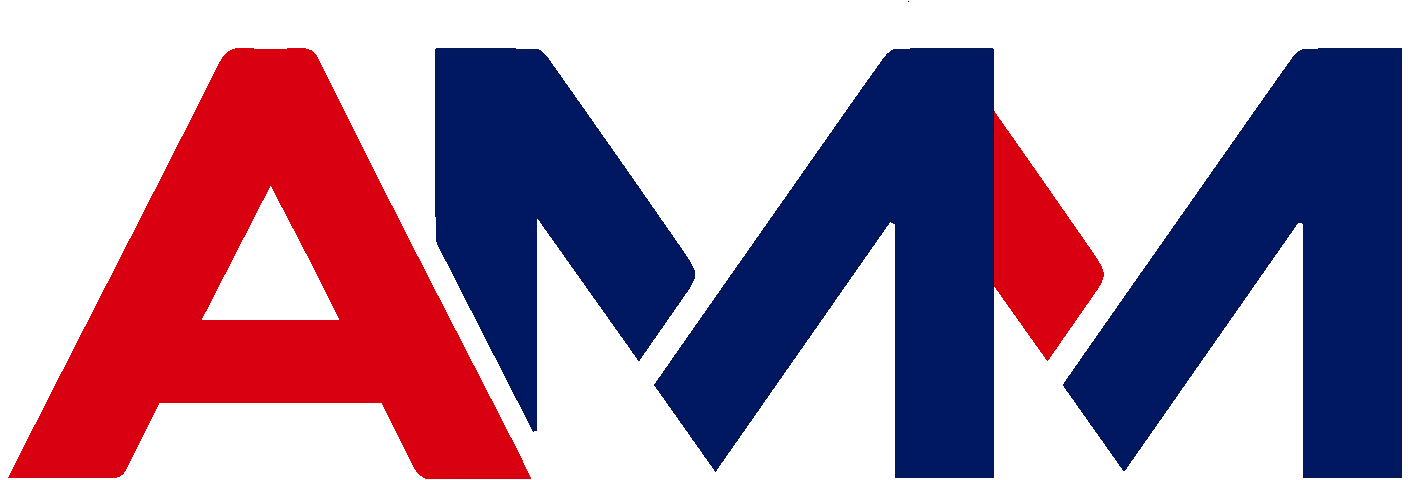
Kommentare
Na, wenn "die Politik" das Problem seit Jahren negiert hat, dann ist Schütz ja in guter Gesellschaft : )
Der Aufstand ist leider unvermeidbar:
Abgesehen, dass niemand ausser den Betroffenen das Problem erkannt hat, glauben auch noch viele, allen voran unser Rektor, dass wir schon alle brav den Mund halten werden und wegen ein paar € Journaldienstabgeltung weiter 60 Stunden arbeiten werden um dann spätestens 2021 eine Gehaltseinbusse hinzunehmen.
Ich denke wenn nicht die Mehrheit weiter 60 Stunden leisten will und parallel Maßnahmen zur Änderung des Systems und Personalaufstockung kommen, dann wird unweigerlich der Betrieb zusammenbrechen und zwar gewaltig.
Und das sollten wir uns "abkaufen" lassen. Ohne eine wirklich spürbare "optout"-Prämie werde ich sicher nicht weiter 60 Stunden arbeiten, da gibt es viele andere Beschäftigungen die mehr Sinn stiften ....
Anbei noch die Folie von der letzten Betriebsversammlung: