Über das Verbesserungspotenzial bei der Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Gesundheitswesen hat praktisch jeder eine Meinung. Politiker, Experten, Patienten. Der Rechnungshof hat sich am Beispiel des Wiener AKH in der ihm eigenen Nüchternheit angesehen, wohin die bekannten Kompetenz- und Zielkonflikte in der Praxis führen. Das Ergebnis ist - trotz der sprachlichen Sachlichkeit - eine 217 Seiten starke gesundheitsökonomische Kampfschrift.
Am Prüfstand standen nicht medizinische oder wissenschaftlichen Qualität, sondern Wirtschaftlichkeit und Administration. Fazit: Der Betrieb des Großspitals ist zu teuer, ineffizient - und zu bürokratisch. Als Wurzel allen Übels identifiziert der Rechnungshof die Organisationsstruktur. Der Bund bezahlt via Medizinische Universität Wien (MUW) das ärztliche Personal, die Stadt Wien stellt Infrastruktur und Pflegekräfte. Während Wien mit dem Spital die eigene Bevölkerung versorgen will, sollen die Mediziner der MUW in erster Linie forschen.
Das Verhältnis zwischen Bund und Wien ist daher ein gespanntes, keine Seite will die Aufgaben der anderen finanzieren. Das führt zu Ineffizienzen. Die Zusammenarbeit der beiden Partner im Haus ist inzwischen derart kompliziert, dass sie in mehr als 20 verschiedenen Einzelverträgen geregelt ist.
Medizinische Leistungen werden in Österreich nach einem Punktesystem mit den Kassen abgerechnet. Je nach Art der Leistung gibt es eine bestimmte Zahl sogenannter LKF-Punkte (LKF steht für leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung). Und für jeden LKF-Punkt gibt es Geld. Laut Rechnungshof sind die Kosten für LKF-Punkte im AKH 30 bis 60 Prozent höher als in den anderen Universitätskliniken in Graz und Innsbruck.
Die Infrastrukturkosten sind doppelt so hoch. Zum Vergleich: Ein Spitalsbett in Graz kostet 118.088 Euro, in Innsbruck 126.897. Im AKH sind es 258.918 Euro. Die anderen Spitäler Wiens arbeiten da deutlich günstiger. Hier liegt der Durchschnittswert bei 97.636 Euro. Erklärbar sind die hohen Kosten unter anderem durch extrem teure Bettensperren. Das bedeutet, dass das Spital weniger Betten betreibt, als eigentlich vorgesehen sind. Zum Beispiel, weil Pflegepersonal fehlt oder zu viele Mitarbeiter krank sind. Die Prüfer fanden heraus, dass von 2100 zulässigen Betten im Prüfzeitraum 2005 bis 2011 je nach Zeitpunkt 250 bis 330 nicht belegbar waren. Dadurch entstanden dem Betrieb jährliche Kosten in der Höhe von 126,27 bis 319,26 Millionen Euro.
Jährlich 25 Tage krank
Außer fehlendem Pflegepersonal nennt der Rechnungshof (siehe oben) vor allem die vielen Krankenstände als Problem. Im Schnitt sind AKH-Mitarbeiter jährlich 25 Tage krank. Österreichweit kommt die Gruppe der Gesundheits- und Sozialberufe jedoch nur auf 14 Tage. Besonders häufig im Krankenstand ist Hilfspersonal (jährlich 44 Tage), es folgen Betriebspersonal (39) und Pflegehelfer (35). Am besten schneiden medizinisches und technisches Personal (17,4 Tage) sowie Pflegekräfte (21,2) ab.
Die Stellungnahmen von Wissenschaftsministerium, MUW und Stadt Wien zu den Kritikpunkten spiegeln die dem ganzen Bericht zu Grunde liegende Kritik der Kompetenzstreitigkeiten wider. Fast immer heißt es darin, dass man sich dem jeweiligen Problem widmen werde, dabei jedoch auch auf die jeweils andere Seite angewiesen sei.
Der Rechnungshof kritisiert am Beispiel AKH-Wien die Zusammenarbeit von Bund und Stadt Wien am Gesundheitssektor. Durch unterschiedliche Kompetenzen und Ziele der Partner komme es zu massiven Konflikten, hohen Kosten und Ineffizienzen. So sind medizinische Leistungen im AKH um 30 bis 60 Prozent teurer als in anderen Unikliniken. Die Kosten pro Spitalsbett machen das doppelte und mehr aus.
Originalbeitrag in: Die Presse
Beitrag des Standard zu dem Bericht des RH
Der RH-Bericht im Original (pdf)
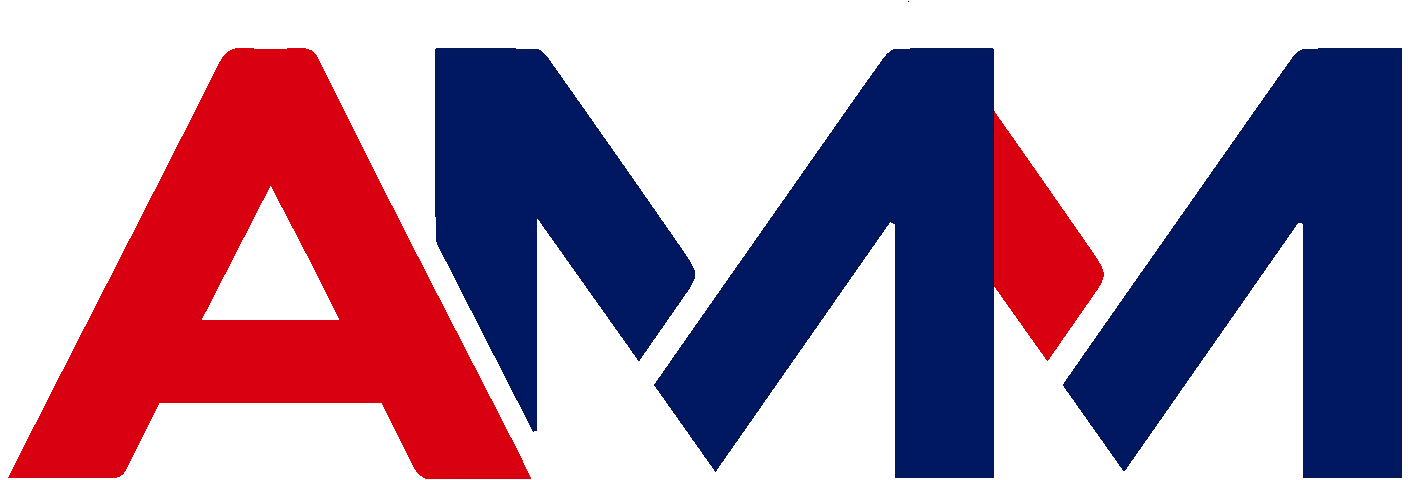
neueste Kommentare