In Deutschland ist ein Medizinstudent im Praktischen Jahr wegen der fahrlässigen Tötung eines Babys verurteilt worden. Der Fall löst eine Debatte aus, wofür angehende Mediziner verantwortlich gemacht werden können und ist auch in Bezug auf die Einführung des KPJ in Österreich von außerordentlicher Brisanz.
Am 22. August 2011 macht ein Medizinstudent einen Fehler, der schlimmste Folgen hat. Er quält ihn bis heute und beschäftigt den gesamten Fachbereich. Im Evangelischen Krankenhaus in Bielefeld entnimmt er, 29 Jahre alt, einem Säugling eine Blutprobe, als eine Krankenschwester ins Zimmer tritt. Sie legt eine Spritze mit einem Antibiotikum bereit. Ein paar Worte fallen. Später im Gerichtssaal wird darüber gestritten, wer was zu wem gesagt habe. Es wird sich nicht eindeutig klären lassen. Klar wird aber: Anstatt das Medikament wie vorgesehen oral zu verabreichen, spritzt der Student es in eine laufende intravenöse Infusion. Daraufhin erleidet das zehn Monate alte Kind einen anaphylaktischen Schock, eine allergische Überreaktion des Immunsystems, und stirbt.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt und bringt den Fall vor Gericht. Der junge Mediziner wird, obwohl er sich zur Zeit des Unglücks noch im Praktischen Jahr (PJ) befindet, für den Fehler allein verantwortlich gemacht. Am 22. Oktober 2012 befindet ihn das Amtsgericht Bielefeld der fahrlässigen Tötung für schuldig und verurteilt ihn zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen seines Gehalts, für ihn als Student sind das 1800 Euro. Er habe ohne ärztlichen Auftrag gehandelt, lautet die Begründung. Außerdem hätte er erkennen müssen, dass das Medikament nicht zur intravenösen Gabe bestimmt gewesen sei.
Während aus dem Krankenhaus niemand belangt wurde, bangt der Student um seine Zukunft als Arzt. Zwar hat er Mitte Januar die Approbation erhalten. Doch mit dem Urteil gilt er als vorbestraft. Ihn plagen nun nicht nur Seelennöte, sondern die Strafe wird auch drei Jahre lang in seinem Führungszeugnis stehen, das bei Bewerbungen angefragt werden kann. »Ich hätte nicht gedacht, dass man mir die alleinige Schuld für das Geschehene anlastet. Ich befürchte negative Folgen für mein weiteres Berufsleben«, lässt er auf Anfrage der ZEIT über seinen Anwalt ausrichten. Er selbst möchte anonym bleiben. Er hat Berufung eingelegt, die Verhandlung steht aus.
Noch nie wurde ein Medizinstudent strafrechtlich belangt
Schon jetzt aber sorgt das Verfahren für Wirbel. Einen Tag nach der Urteilsverkündung schrieb der Studiendekan Bernhard Marschall der Medizinischen Fakultät in Münster, wo der PJler eingeschrieben war, eine lange Mail an seine rund 2500 Medizinstudenten, in der er den Verurteilten verteidigte. Dieser habe während des PJ häufig intravenöse Injektionen durchgeführt und es auch diesmal als seinen Auftrag verstanden. In dieser Situation hätte fast jeder Student so gehandelt, behauptete Marschall. Die Münsteraner Studenten waren alarmiert. Sie gaben eine Stellungnahme heraus, in der sie von der Unsicherheit berichteten, die der Fall bei ihnen ausgelöst hat. Sie wüssten nun nicht mehr, was sie im PJ dürfen und was nicht.
Tatsächlich existiert kein Regelwerk, das die Aufgaben eines PJlers exakt definiert. Die angehenden Mediziner aus Münster schreiben: »Uns bleibt bei Bestehenbleiben dieses Urteils lediglich die Möglichkeit, jede potenziell patientenschädigende Maßnahme zu verweigern.« Das aber beträfe nahezu jede Behandlung. Würden sie ihre Drohung in die Tat umsetzen, hätten die Krankenhäuser ein Problem, denn PJler sind aus Dienstplänen nicht wegzudenken. Der Nachwuchs soll Ärzte und Pflegekräfte entlasten und führt Arbeiten aus, die jeden Tag geleistet werden müssen, wie Zugänge legen und Blut abnehmen. Im hektischen Klinikalltag bleibt keine Zeit, sich jedes Mal zu fragen, ob sie das dürfen.
Dass ein Mediziner in Ausbildung strafrechtlich belangt wird, ist auch für Peter Ernst von der Juristischen Fakultät in Düsseldorf neu. Er promoviert über die »Haftung des Arztes im Praktischen Jahr«, ein Thema, mit dem sich bislang niemand intensiv auseinandergesetzt habe. Wenn sich Medizinstudenten in der Vergangenheit vor Gericht verantworten mussten, ging es stets um zivilrechtliche, nie um strafrechtliche Verfahren, sagt Ernst. Dennoch hält er das Bielefelder Urteil für angemessen: »Der Student hat eigenmächtig gehandelt. Hätte er Zweifel gehabt, hätte er sich beim behandelnden Arzt erkundigen müssen.«
Auch der Münchner Anwalt Klaus Ulsenheimer, dessen Kanzlei den Studenten im Berufungsverfahren vertritt und sich seit 30 Jahren mit Arztstraf- und -haftungsrecht befasst, hat bisher keinen vergleichbaren Fall erlebt. Trotzdem ist er nicht verwundert. Rechtsfragen spielten in der Patientenbehandlung eine immer größere Rolle, sagt er. Das Urteil sei ein Fanal. »Es zeigt, dass Studenten vom Haftungsrecht nicht ausgenommen sind.«
An der Medizinischen Fakultät in Münster erneuerten Professoren und Studenten vor Kurzem auf einer Pressekonferenz ihre Kritik. Anders als es der Richter festgestellt hat, behaupten sie, dass ihr Kommilitone den Unterschied zwischen einem oral und einem intravenös zu verabreichenden Medikament nicht erkennen konnte. Die jeweiligen Spritzen in dem Krankenhaus hätten identisch ausgesehen. Sie vermuten daher ein Organisationsverschulden. Bestärkt fühlen sie sich dadurch, dass die Bielefelder Klinik am Tag nach dem Unglück ihr Spritzensystem umgestellt hat. Der Kliniksprecher bestätigt sowohl den Spritzenwechsel als auch, dass es sich vorher um den gleichen Spritzentyp gehandelt habe. Die Bundesärztekammer verweigert mit Verweis auf das laufende Verfahren eine Stellungnahme.
Logbücher sollen Wissensstand der Studenten dokumentieren
Im April tritt eine neue Verordnung für das PJ in Kraft. Der zufolge müssen die Fakultäten ihre Studenten mit Logbüchern ausstatten, die ihren Wissensstand dokumentieren. Mehr Rechtssicherheit verschaffen die Bücher aber nicht. Ob ein Student haftbar ist, wird immer vom Einzelfall abhängen, sagen Medizinrechtler. Ob wenigstens die Ausbildung im PJ durch die Logbücher verbessert wird? »Das hoffen wir. Wichtig ist, dass sich Ärzte mit uns regelmäßig über die Inhalte austauschen«, sagt Martin Schmidt von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden. »Wir müssen grundsätzlich besser angeleitet und betreut werden. Dafür müssen die Krankenhäuser mehr Personal zur Verfügung stellen.«
Die Medizinische Fakultät Münster will mit ihren Lehrkrankenhäusern künftig genauere Vereinbarungen treffen, welche Arbeit ein Student übernehmen darf. Die Zusammenarbeit mit dem Bielefelder Krankenhaus ist seit September 2012 ausgesetzt, die Klinik ist eine neue Kooperation mit einer Universität aus Ungarn eingegangen. Dass sich diese Vorgänge genau zwischen dem Tod des Kindes und dem umstrittenen Urteilsspruch abspielten, ist laut dem Sprecher der Medizinischen Fakultät nur ein »dummer Zufall«.
Quelle: Die Zeit
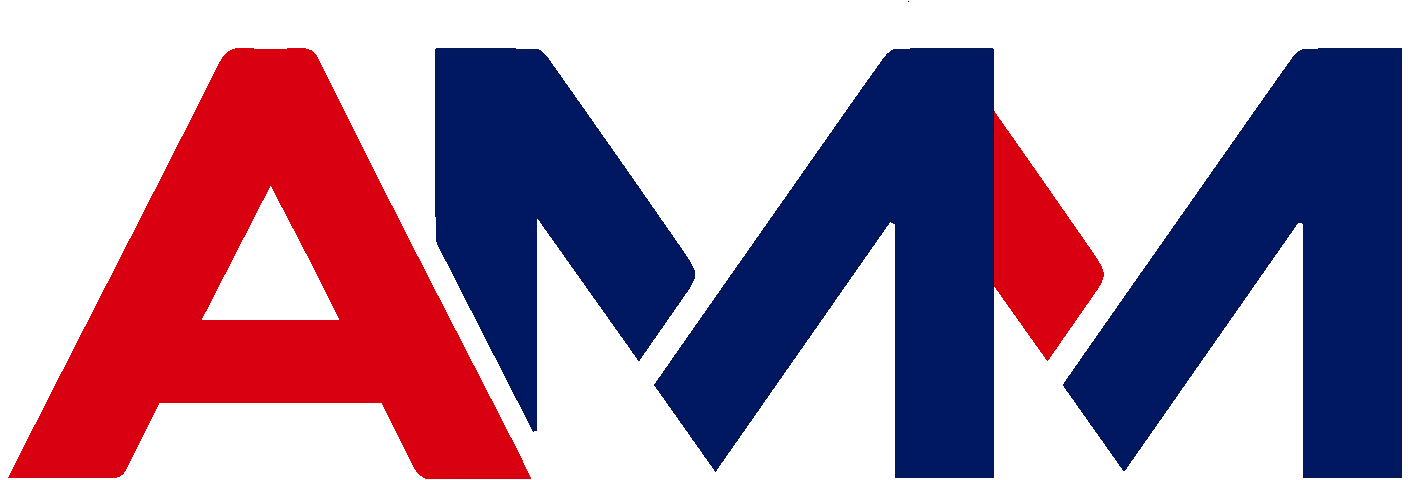
Kommentare
Muß klar definiert werden,was erlaubt od was verboten ist,muss auch von den anderen österr. Unis einheitlich definiert werden,und muss in allen Krankenhäusern gleich eingehalten werden.Gibt aber auch dann keine Rechtssicherheit,denn ein Richter kann das durchaus auch anders sehen.